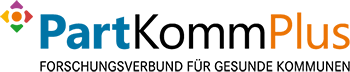Wirkungsbeschreibung PartKommPlus – Forschungsverbund für gesunde Kommunen
Berlin, 04.02.2021

Zusammenfassung
PartKommPlus - Forschungsverbund für gesunde Kommunen war ein Forschungsverbund, der zwischen 2015 und 2021 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. PartKommPlus stellte das bisher größte Forschungsvorhaben in Deutschland dar, das nach dem Ansatz der Partizipativen Gesundheitsforschung arbeitete. Der Verbund verfolgte das Ziel Partizipation unter unterschiedlichen Bedingungen im Rahmen kommunaler Strategien der Gesundheitsförderung zu untersuchen. Außerdem sollten die Anwendungsmöglichkeiten von Partizipativer Gesundheitsforschung als gesundheitswissenschaftlichem Ansatz in der deutschen Wissenschafts- und Praxislandschaft erörtert werden. PartKommPlus bestand aus sieben Teilprojekten in acht Bundesländern und einer Koordinierungsstelle, die mit dem redaktionell betreuten Onlineportal inforo kooperierten.
In der zweiten Förderphase von PartKommPlus lag ein Schwerpunkt der Arbeit darauf, die (beabsichtigten wie unbeabsichtigten) Wirkungen des Verbundes zu identifizieren, zu belegen und nachvollziehbar zu beschreiben. Basierend auf den Ergebnissen von Wirkungskarten, einer Analyse verbundinterner Dokumente sowie ergänzenden kommunikativen Verfahren auf Verbundebene wurden Wirkungen und Wirkungswege auf drei verschiedenen Ebenen festgestellt:
- Wirkungen auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene: Wirkungen auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene waren bespielhaft in der Form einer wechselseitigen Sensibilisierung gegenüber den Anliegen und Perspektiven der unterschiedlichen Beteiligtengruppen oder auch als Prozess des Empowerments bei den Beteiligten festzustellen. Begünstigend hierfür waren die im Forschungsprozess ermöglichten Räume für Austausch, Selbst- und Prozessreflexionen sowie wechselseitiges Lernen.
- Wirkungen auf Ebene der Praxis: Wirkungen auf dieser Ebene betrafen vor allem einen Wissens- und Kompetenzgewinn hinsichtlich der Umsetzung partizipativer Arbeitsweisen in der kommunalen Gesundheitsförderung. Durch die Erfahrungen innerhalb des Forschungsprozesses veränderte sich die Arbeitsweise von beteiligten Praktiker*innen; durch die Verbreitung von Ergebnissen und Produkten, wie Arbeitshilfen, konnten darüber hinaus auch Praktiker*innen außerhalb des Verbundes erreicht werden.
- Wirkungen auf Wissenschaftsebene: Auf der Wissenschaftsebene konnte PartKommPlus Interesse an Partizipativer Gesundheitsforschung unter Wissenschaftler*innen wecken bzw. bestärken und Auseinandersetzungen über diesen Forschungsansatz anregen. Dies geschah vorwiegend über Lehre, Publikationen, Vorträge und Netzwerkarbeit.
Die Beschäftigung mit dem Thema Forschungsimpact/ Wirkungen machte deutlich, dass Partizipative Gesundheitsforschung lokales Wissen erzeugt und positive Wirkungen besonders dort möglich werden, wo die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Beteiligtengruppen gelingt. Insgesamt konnte PartKommPlus mit dazu beitragen, dass sich die Bedingungen für die Partizipative Gesundheitsforschung in Deutschland derzeit verbessern und damit einer weiteren Entwicklung und Etablierung dieses Forschungsansatzes den Weg ebnen.
Projektvorstellung
Kommunale Strategien der Gesundheitsförderung spielen eine zentrale Rolle, um Menschen von Geburt an ein gesundes Leben zu ermöglichen. Partizipation wird hierbei als ein wesentliches Kriterium für gute gesundheitsfördernde Praxis angesehen. PartKommPlus untersuchte mit dem Ansatz der Partizipativen Gesundheitsforschung, wie in verschiedenen Settings und mit unterschiedlichen Akteur*innen Partizipation in der kommunalen Gesundheitsförderung gelingen kann. In der Partizipativen Gesundheitsforschung arbeiten Wissenschaftler*innen, Fachkräfte und engagierte Bürger*innen aus verschiedenen Kontexten zusammen, um besser verstehen zu können, was Menschen gesund hält und was sie krank macht. Aufgrund der Erkenntnisse werden Maßnahmen zur Gesundheitsförderung entwickelt. Ein zentrales Merkmal der Partizipativen Gesundheitsforschung ist die Durchführung von Forschungstätigkeiten vor Ort, gemeinsam mit Menschen, die von dem Forschungsthema betroffen sind und/oder praktisch sowie politisch Einfluss auf Gesundheitsfragen nehmen können.
PartKommPlus verfolgte zwei Ziele:
(1) Die Gewinnung neuer und nachvollziehbarer (evidenzbasierter) Erkenntnisse über die fördernden und hemmenden Bedingungen für eine gelungene Partizipation in der kommunalen Gesundheitsförderung. Besondere Berücksichtigung dabei finden
- die Beteiligung benachteiligter Gruppen an kommunalen Prozessen,
- die Förderung der Zusammenarbeit von Praxisakteur*innen und deren Koordination (Governance),
- die Untersuchung unterschiedlicher Formen der Partizipation und deren Wirkung im Rahmen kommunaler Strategien,
- die Erprobung partizipativer Methoden der Gesundheitsberichterstattung,
- die Rolle der Partizipation in kommunalen Planungsprozessen,
- die Möglichkeiten der nachhaltigen Etablierung der Partizipation im Rahmen kommunaler Strategien.
(2) Partizipative Gesundheitsforschung als gesundheitswissenschaftlichen Ansatz im Bereich der Gesundheitsförderung in Deutschland in Zusammenarbeit mit der International Collaboration for Participatory Health Research (ICPHR) weiterentwickeln.
Die Forschungsfragen des Verbundes wurden im Arbeitsprozess angepasst und lauteten:
- Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit in der kommunalen Gesundheitsförderung (zwischen Fachakteur*innen und Bürger*innen untereinander) bezüglich Struktur und Qualität? (Zusammenarbeit)
- Wie können die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung kommunaler Strategien der Gesundheitsförderung gesteuert werden? (Governance)
- Wie kann kommunale Gesundheitsförderung so gestaltet werden, dass Stakeholder aus verschiedenen Sektoren (z. B. Kommunalverwaltung, Kommunalpolitik, Krankenkassen, Zivilgesellschaft, Verbände/Vereine) und die Bewohnerschaft, v. a. unter Einbezug von Menschen aus vulnerablen Bevölkerungsgruppen partizipieren? (Formen der Partizipation)
- Welche Auswirkungen hat Partizipation von Akteur*innen aus verschiedenen Sektoren und Adressatengruppen auf das Gelingen kommunaler Gesundheitsförderung? (Auswirkung)
- Welche Methoden der Partizipativen Gesundheitsforschung sind effektiv, um kommunale Gesundheitsförderung zu unterstützen? (Methoden)
- Welche Beiträge können partizipative Ansätze der Epidemiologie, Gesundheitsberichterstattung (GBE) und -planung für die kommunale Zusammenarbeit im Bereich Gesundheitsförderung leisten und vice versa? (partizipative Epidemiologie/GBE)
- Was sind die förderlichen und hemmenden Bedingungen für eine gelingende Zusammenarbeit in einem partizipativ forschenden Verbundprojekt? (Partizipative Forschung im Verbund)
PartKommPlus bestand aus sieben Teilprojekten in acht Bundesländern, inforo sowie der Koordinierungsstelle:
- ElfE - Eltern fragen Eltern: Im Teilprojekt ElfE forschten Eltern, Praxispartner*innen und Wissenschaft in zwei Fallstudien gemeinsam zu der Fragestellung, wie die Entwicklung von allen Kindern durch den Kita-Besuch noch besser gefördert werden kann.
- PEPBS - Partizipative Evaluation der Präventionskette Braunschweig: Gemeinsam mit der Stadt Braunschweig untersuchte das Teilprojekt PEPBS exemplarisch, welche Faktoren ausschlaggebend sind, um lebensphasenorientierte Unterstützungsstrukturen für Kinder und Jugendliche zu gestalten.
- KEG - Kommunale Entwicklung von Gesundheitsstrategien: Wissenschaft und Praxis im Dialog: Im Teilprojekt KEG wurden die Anliegen und Interessen von Fachakteur*innen (Netzwerkmitgliedern) und Anwohner*innen ausgewählter Stadtbezirke in Esslingen und in Hamburg stadtteilbezogen und alltagsnah erhoben und die kommunale Gesundheitsförderung vor Ort gemeinsam mit Akteur*innen des Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswesens weiterentwickelt.
- Gesunde Stadtteile für Ältere - Age4Health: Im Mittelpunkt des Forschungsprojekts Age4Health standen in zwei Fallstudien (Stadt Kassel, Stadtteil Bettenhausen und Stadt Witzenhausen im Werra-Meißner-Kreis) die Erforschung kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten für eine gelingende Beteiligung älterer Menschen – insbesondere derer in schwierigen Lebenslagen – und damit die Entwicklung von inklusiven und gesundheitsförderlichen Quartieren/Nachbarschaften.
- GESUND! - Menschen mit Lernschwierigkeiten und Gesundheitsförderung: Das Projekt GESUND! forschte gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten und ging der Frage nach, wie Gesundheitsförderung mit dieser Adressat*innengruppe gestaltet und kommunal verankert werden kann.
- K3 - Kommunen und Krankenkassen – Kooperationen für gesunde Lebenswelten vor Ort: Das Teilprojekt K3 führte eine Befragung zur Steuerung und Kooperation bei der Entwicklung und Umsetzung integrierter Strategien kommunaler Gesundheitsförderung durch und untersuchte anhand von drei Fallstudien, wie eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Krankenkassen im Bereich Primärprävention und Gesundheitsförderung in kommunalen Lebenswelten initiiert und etabliert werden kann.
- P&E - Partizipative Epidemiologie: Von Daten zu Empfehlungen: Das Teilprojekt P&E beschäftigte sich gemeinsam mit Partner*innen aus dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, der Public-Health-Praxis und aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen mit der Frage, wie Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung durch die Anwendung partizipativer Forschungsansätze weiterentwickelt werden können.
- inforo: inforo online ist die kommunale Austauschplattform für Gesundheitsförderung und Prävention. PartKommPlus und seine Teilprojekte waren als eigenständiges Fachmodul auf inforo vertreten. Dort wurden Arbeitsergebnisse gebündelt und Fachkräften zur Verfügung gestellt.
- Koordinierungsstelle: Die Koordinierungsstelle mit Sitz an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin koordinierte den Forschungsverbund, damit die gemeinsamen Forschungsziele im vorgesehenen Zeitraum erreicht werden konnten.
Die Teilprojekte wurden so konzipiert, dass unterschiedliche kommunale Strukturen, Strategien der Gesundheitsförderung, Bevölkerungsgruppen und Forschungsmethoden Berücksichtigung fanden. Diese Vielfalt bot die Möglichkeit, Partizipation im Rahmen von kommunalen Strategien der Gesundheitsförderung unter unterschiedlichen Bedingungen und auf Grundlage unterschiedlicher Datenbestände zu untersuchen. Die Arbeit in den Kommunen wurde teilweise in Kooperation mit den Landesvereinigungen für Gesundheit realisiert, um eine strukturelle Verankerung der Vorhaben zu sichern. Um allgemeingültige Aussagen für die Gesundheitsförderung treffen zu können, sollten die Ergebnisse aus allen Teilprojekten systematisch zusammengeführt werden (Integration und Synthese). PartKommPlus ging aus dem Netzwerk Partizipative Gesundheitsforschung (PartNet) hervor und wurde insgesamt sechs Jahre über zwei Förderphasen hinweg mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.
Verbundübergreifende Ergebnisse wurden in der ersten Förderphase über ein angepasstes Delphi-Verfahren generiert und in Form eines Ergebnis- und Empfehlungspapiers auf der Internetseite des Verbundes veröffentlicht. Zudem entstanden in der ersten und zweiten Förderphase im Rahmen eines kooperativen Prozesses verschiedene Publikationen, die im Folgenden unter „Produkte“ aufgelistet sind. Verbundpartner*innen kamen hierfür in unterschiedlichen Konstellationen (teilprojektübergreifend, Wissenschaftler*innen und Praxispartner*innen) zusammen, um Themen zu bearbeiten, die einerseits einen unmittelbaren Bezug zu ihrer Forschungstätigkeit und ihrer Rolle im Forschungsprozess hatten und andererseits gemeinsame übergeordnete Fragestellungen betrafen.
Beteiligte Personen und Organisationen
Eine Auflistung der verschiedenen am Verbund beteiligten Personen und Organisationen finden Sie auf der Seite "Mitglieder des Verbundes".
Produkte
Die einzelnen Teilprojekte des Verbundes erarbeiteten vielfältige Produkte, die auf deren Seiten einzusehen sind.
Als Gesamtverbund gestaltete PartKommPlus in (Mit-)Herausgeberschaft folgende Veröffentlichungen:
- Schwerpunktheft zu Wirkungen in der Partizipativen Gesundheitsforschung: Wright M T, Salsberg J, Hartung S (2018) Impact in Participatory Health Research. BioMed Research International 2018:3907127.
- Sammelband zu Partizipativer Gesundheitsforschung weltweit: Wright M T, Kongats K (Hrsg) (2018) Participatory Health Research. Voices from Around the World. Springer, Cham, Switzerland
- Sammelband (Open-Access) zu Methoden Partizipativer Gesundheitsforschung: Hartung S, Wihofszky P, Wright M T (Hrsg) (2020) Partizipative Forschung. Ein Forschungsansatz für Gesundheit und seine Methoden. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden
- Themenheft zu Gesundheitlicher Chancengleichheit und Partizipativer Gesundheitsforschung: Bär G, Santos-Hövener C, Sass A, Wright M T (2021) Partizipative Gesundheitsforschung. Gesundheitliche Chancengleichheit durch gemeinsames Forschen verbessern. Bundesgesundheitsblatt 64(2)
Diese Einzelbeiträge wurden teilprojektübergreifend zu übergeordneten Fragestellungen erarbeitet:
- Bach M, Wright M T, Hartung S, Santos-Hövener C, Jordan S (2016) Participatory epidemiology: advancing the theory and practice. European Journal of Public Health 26(suppl_1). https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw170.074
- Bach M, Jordan S, Hartung S, Santos-Hövener C, Wright M T (2017) Participatory epidemiology: the contribution of participatory research to epidemiology. Emerg Themes Epidemiol 14:2. https://doi.org/10.1186/s12982-017-0056-4
- Wright M T, Hartung S, Bach M, Brandes S, Gebhardt B, Jordan S, Schaefer I Wihofszky P (2018) Impact and Lessons Learned from a National Consortium for Participatory Health Research. PartKommPlus - German Research Consortium for Healthy Communities (2015–2018). BioMed Research International 2018(2): 5184316. doi.org/10.1155/2018/5184316
- Wright M T, Burtscher R, Wihofszky P (2018) PartKommPlus: German Research Consortium for Healthy Communities—New Developments and Challenges for Participatory Health Research in Germany. In: Wright M T, Kongats K (Hrsg) Participatory Health Research. Springer International Publishing, Cham, S 117–126
- Hartung S, Wihofszky P, Wright M T (2020) Partizipative Forschung – ein Forschungsansatz für Gesundheit und seine Methoden. In: Hartung S, Wihofszky P, Wright M T (Hrsg) Partizipative Forschung. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, S 1–19
- Wihofszky P, Wright MT, Kümpers S, Layh S, Bär G, Schaefer I (2020) Reflektieren in Forschungsgemeinschaften: Ansatzpunkte, Formate und Erfahrungen. In: Hartung S, Wihofszky P, Wright M T (Hrsg) Partizipative Forschung. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, S 63–84
- Wihofszky P, Hartung S, Allweiss T, Bradna M, Brandes S, Gebhardt B, Layh S (2020) Photovoice als partizipative Methode: Wirkungen auf individueller, gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene. In: Hartung S, Wihofszky P, Wright M T (Hrsg) Partizipative Forschung. Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, S 85–141
- Bär G, Hövener C, Wright MT, Saß A-C (2021) Demokratisch und emanzipatorisch – Partizipative Gesundheitsforschung hat hohes Potenzial (Democratic and emancipatory-participatory health research has a high potential). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 64:137–139. doi.org/10.1007/s00103-020-03276-8
- Schaefer I, Narimani P (2021) Ethische Aspekte in der partizipativen Forschung – Reflexion von Herausforderungen und möglichen Beeinträchtigungen für Teilnehmende (Ethics in participatory research-reflection on challenges and possible impairments for participants). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 64:171–178. doi.org/10.1007/s00103-020-03270-0
- Kümpers S, Brandes S, Gebhardt B, Kühnemund C (2021) Rollen und Rollendynamiken in der partizipativen Forschungsgemeinschaft (Roles and their dynamics in participatory research communities). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 64:156–162. doi.org/10.1007/s00103-020-03272-y
- Schaefer I, Kümpers S, Cook T (2021) „Selten Gehörte“ für partizipative Gesundheitsforschung gewinnen: Herausforderungen und Strategien (Involving the seldom heard in participatory health research: challenges and strategies). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 64:163–170. doi.org/10.1007/s00103-020-03269-7
- Hilgenböcker E, Bär G, Kühnemund C (2021) Verstetigung partizipativer Forschung über das Projektende hinaus: Partizipative Qualitätsentwicklung in der kommunalen Gesundheitsförderung (Continuing participatory research beyond the end of projects: participatory quality development in municipal health promotion). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 64:207–214. doi.org/10.1007/s00103-020-03271-z
- Praxispartner*innen/Mitforschende des Forschungsverbundes PartKommPlus (2021) „DIE UMSETZUNG ERFOLGT VOR ORT“. Diskussionspapier der Praxispartner*innen und Mitforschenden des Forschungsverbundes, Berlin. Stand: März 2021.
Darüber hinaus wurden über inforo 4 Newsletter aus PartKommPlus an die Mitglieder der Fachkräfteplattform gesendet und zahlreiche Beiträge aus den Teilprojekten auf der Seite veröffentlicht.
Finanzierung
Der Forschungsverbund PartKommPlus wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms ‚Präventionsforschung‘ unter den Förderkennzeichen 01EL1423A-H (1. Förderphase 2015-2018) und 01EL1823A-H (2. Förderphase 2018-2021) gefördert.
Wirkungsbeschreibung
Hintergrund
Der Forschungsverbund PartKommPlus arbeitete nach dem Ansatz der Partizipativen Gesundheitsforschung. Das bedeutet, dass nicht nur Wissensgenerierung, sondern auch Veränderungen in der Lebenswelt zur Förderung der Gesundheit angestrebt wurden. Aus diesem Grund widmete sich der Verbund in seiner zweiten Förderphase der Frage, welche Wirkungen durch die eigene Forschungstätigkeit angeregt und erzielt werden konnten. Dieser Text wurde basierend auf den Ergebnissen von Wirkungskarten (sogenannten Impact-Mappings), einer Dokumentenanalyse verbundinterner Protokolle und Dokumentationen sowie ergänzenden kommunikativen Verfahren zur Erweiterung und Validierung der Ergebnisse geschrieben (mehr Informationen zum methodischen Vorgehen bei der Erstellung der Wirkungsbeschreibungen in PartKommPlus finden Sie hier). Die Erfassung der eigenen Wirkungen war durch besondere Herausforderungen gekennzeichnet. So konnte beispielsweise nur schwer eine klare Trennung zwischen den Veränderungen durch den Forschungsverbund als Einheit und den Veränderungen durch die einzelnen Teilprojekte vorgenommen werden. Diese Schwierigkeit konnte nicht gänzlich aufgelöst werden und somit gelten nicht alle hier getroffenen Aussagen für alle Teile des Verbundes gleichermaßen.
Im Verlauf der ersten Förderphase beschrieben in PartKommPlus tätigen Wissenschaftler*innen Wirkungen, die der Verbund aus ihrer Sicht anstreben und erreichen könnte [1]. Sie leiteten diese intendierten Wirkungen aus den aktualisierten Verbundzielen ab. Demnach sollte PartKommPlus dazu beitragen, dass
- Wirkungen bei den beteiligten Personen im Verbund eintreten (z. B. durch das Einnehmen neuer Perspektiven, Erlernen neuer Formen der Forschungspraxis, Entwickeln neuer Ideen zur Gesundheitsförderung oder die Entwicklung von Empowerment und gestärkter Selbstwirksamkeitserwartung);
- Wirkungen in den beteiligten Kommunen angestoßen werden (v. a. bezogen darauf, wie Strategien der Gesundheitsförderung geplant und umgesetzt werden, mit besonderem Schwerpunkt auf der Ermöglichung von Partizipation);
- Wirkungen auf die Praxis der kommunalen Gesundheitsförderung erreicht werden (z. B. indem Themen aus PartKommPlus aufgegriffen, Leitfäden und Instrumente aus PartKommPlus angewendet, adaptiert oder kritisiert werden);
- und dass Wirkungen innerhalb der nationalen Wissenschaftslandschaft erzielt werden (z. B., dass Partizipative Gesundheitsforschung als gesundheitswissenschaftlicher Ansatz im Bereich der Gesundheitsförderung in Deutschland bekannter, verbreiteter und stärker etabliert wird).
Im Forschungsverbund PartKommPlus arbeiteten verschiedene Personengruppen in unterschiedlichen Konstellationen zusammen: Bürger*innen aus verschiedenen Settings und mit unterschiedlichen Hintergründen, Wissenschaftler*innen sowie Praktiker*innen aus Bereichen wie der Gesundheitsförderung, Heilpädagogik, Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, Kommunalverwaltung oder Stadtentwicklung. So verschieden die Beteiligten waren, so unterschiedlich erwiesen sich auch die Begrifflichkeiten, die für oder von den Personengruppen gewählt wurden (z. B. Peer-Forschende, Praxispartner*innen, akademisch Forschende). In den Fallstudien und auf Verbundebene wurden verschiedene Strukturen für die Zusammenarbeit geschaffen. Zu nennen wären hier in den Fallstudien beispielsweise Runde Tische, Forschungsseminare oder -werkstätten, Begleit- oder Steuerungsgruppen sowie im Verbund Kolloquien und Koordinierungsrunden. Weitere Informationen zu den Besonderheiten und Strukturen eines partizipativ arbeitenden Verbundes finden Sie in der Wirkungsbeschreibung der Koordinierungsstelle.
Die identifizierten Wirkungen und Wirkungswege von PartKommPlus werden im Folgenden auf drei verschiedenen Ebenen vorgestellt: 1) Wirkungen auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene, 2) Wirkungen auf Ebene der Praxis und 3) Wirkungen auf Wissenschaftsebene. Im Text werden auf weiterführende Beschreibungen der Wirkungen sowie auf verschiedene Beispiele aus den Teilprojekten des Verbundes verwiesen, die im Anhang zu finden sind. Im Resümee werden die beschriebenen Wirkungen mit den ursprünglich angestrebten Wirkungen verglichen.
Wirkungen und Wirkungswege in PartKommPlus
Teil 1: Wirkungen auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene
Die Erfahrungsräume, die im Rahmen der partizipativen Zusammenarbeit vor Ort und zu einem gewissen Grad auch teilprojektübergreifend eröffnet wurden, können als wesentliche Größe für vielschichtige Wirkungen bei den einzelnen Individuen und Personengruppen angesehen werden [2]. Innerhalb dieser Erfahrungsräume wurden Begegnungen zwischen den unterschiedlichen Beteiligtengruppen ermöglicht; Austausch sowie Selbst- und Prozessreflexionen fanden statt und wechselseitiges Lernen wurde gefördert. Beziehungsaufbau, vertrauensbildende Maßnahmen, gegenseitige Akzeptanz und Wertschätzung als auch die Etablierung einer konstruktiven „Streitkultur“ bildeten hierfür wichtige Voraussetzungen [3].
Auch wenn es nicht immer einfach war, sich gegenseitig zu verstehen, erfolgte in der partizipativen Zusammenarbeit eine wechselseitige Sensibilisierung gegenüber den Anliegen und Perspektiven der unterschiedlichen Beteiligtengruppen [2]. So erkannten beispielsweise die Wissenschaftler*innen die spezifische Expert*innenrolle der Bürger*innen an. Die verschiedenen Sichtweisen der Beteiligten wurden als bereichernd erlebt und es konnte wiederholt die Bereitschaft beobachtet werden, auf die Belange einzelner Personen oder Gruppen einzugehen und für diese einzutreten [2]. Durch eine wertschätzende und ressourcenorientierte Zusammenarbeit konnten sich insbesondere die mitforschenden Bürger*innen ermächtigen und ihre Selbstvertretungskompetenz stärken [2, 3].
Weiterführenden Informationen und Beispiele der Wirkungen von PartKommPlus auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene sind im Anhang zu finden.
Teil 2: Wirkungen in der Praxis
Die Veränderungen auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene bedingten vielfach Wirkungen in der Praxis der beteiligten Partner*innen [2]. Der Wissens- und Kompetenzgewinn, die Sensibilisierung für bestimmte Themen und die Erfahrungen, die in der partizipativen Forschungsarbeit in den Fallstudien gesammelt wurden, führten etwa dazu, dass Fachkräfte in ihrem jeweiligen Setting überprüften, wo Partizipationsmöglichkeiten erweitert werden könnten. Ferner wurden in vielen Fallstudien von PartKommPlus kommunale Netzwerke aufgebaut, wiederbelebt und/oder gestärkt [2]. Mit den Methoden und Instrumenten für partizipatives Arbeiten, die zum Teil gemeinsam entwickelt und erprobt wurden, entstanden Hilfsmittel, die innerhalb und außerhalb von PartKommPlus Anwendung fanden [2]. Die konkreten Forschungsergebnisse und die daraus entwickelten Produkte trugen zu Veränderungsprozessen vor Ort bei.
PartKommPlus erreichte neben den direkt oder indirekt beteiligten Praktiker*innen vor Ort weitere Akteur*innen, wodurch Wirkungen in der Praxis auch außerhalb des Verbundes angestoßen werden konnten. Förderlich dafür war wahrscheinlich, dass bereits ein Interesse an partizipativer Forschung und vor allem an Partizipation in der Gesundheitsförderung bei Praktiker*innen aus Sozial- und Gesundheitsberufen, Verwaltungsmitarbeiter*innen und Kommunalpolitiker*innen bestand [2].
Wichtige Mechanismen für Wirkungen auf dieser Ebene waren eine aktive Vernetzungsarbeit und Kontaktpflege sowie Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen in Form vielseitiger Produkte. Letztere wurden auf verschiedenen Wegen breit gestreut (z. B. in Fachzeitschriften, auf inforo oder auf dieser Website unter Produkte). Nachfragen und Kommentare zu einigen der Produkte zeigen, dass diese positiv aufgenommen wurden und Interesse an partizipativer Forschung und/oder Partizipation in der Gesundheitsförderung weckten bzw. bestärkten [2]
Weiterführenden Informationen und Beispiele der Wirkungen von PartKommPlus auf der Ebene der Praxis sind im Anhang zu finden.
Teil 3: Wirkungen auf der Wissenschaftsebene
Zugleich waren auch Wirkungen auf der Wissenschaftsebene wahrzunehmen und wurden zum Teil über ähnliche Wege generiert: So profitierten die beteiligten Wissenschaftler*innen von den Erfahrungen, die sie in ihren Fallstudien und im Verbund machten. Viele entwickelten ihre eigene Haltung und ihr professionelles Handeln weiter, was sich in ihrer Arbeitsweise widerspiegelte und weiterführende Wirkungen begünstigte [2, 3]. Sie konnten beispielsweise den Aufgaben in den Fallstudien mit gewachsener Selbstsicherheit nachgehen und die Chancen und Herausforderungen partizipativen Forschens zunehmend differenziert nach außen vertreten.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Verbundes wurden über Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie über eine spezifische Veröffentlichungsstrategie verbreitet [2]. Die Koordinierungsstelle von PartKommPlus suchte zum Beispiel Kontakt mit Wissenschaftler*innen, die als „Multiplikator*innen“ angesehen werden können und lud sie in den Beirat des Verbundes oder als Gäste und Vortragende zu Kolloquien ein [2]. Ferner nahmen Verbundmitglieder an Konferenzen teil, um sich dort weiter zu vernetzen und über Erkenntnisse aus PartKommPlus zu berichten (siehe Präsentationen). Ende 2020 organisierte PartKommPlus eine eigene Online-Workshopreihe, in der u. a. Mitglieder des Verbundes ihre Arbeit vorstellten und mit den Teilnehmenden diskutierten.
Der Verbund PartKommPlus gewann während seiner Laufzeit an Bekanntheit und schien für viele interessierte Wissenschaftler*innen in besonderem Maße für Partizipative Gesundheitsforschung zu stehen; wahrscheinlich auch, weil es in Bezug auf seine Größe und das Fördervolumen bis dahin kein vergleichbares Forschungsvorhaben in Deutschland gab [2]. Die so entstandene Reputation bewirkte, dass zahlreiche Anfragen aus dem Wissenschaftsbereich die Mitglieder des Verbundes erreichten: Einladungen zu Kongressen, Workshops und Expert*innenhearings, Ernennungen in wissenschaftliche Projektbeiräte und Angebote, Kapitel für geplante Sammelbände zu verfassen [2].
Um eine strukturelle Stärkung Partizipativer Gesundheitsforschung zu unterstützen, wurden Netzwerke gestärkt und ausgebaut, strategisch Arbeitsschwerpunkte gesetzt und spezifische Veröffentlichungen gefördert. Damit sollte der Mehrwert Partizipativer Gesundheitsforschung verdeutlicht, und für den Forschungsansatz in der Wissenschaftspolitik und in den Sozial- und Gesundheitswissenschaften geworben werden. [2].
PartKommPlus konnte über die verschiedenen Wirkungswege das Interesse an Partizipativer Gesundheitsforschung unter Akademiker*innen wecken bzw. bestärken und Auseinandersetzungen über diesen Forschungsansatz anregen. Insgesamt trug der Verbund dazu bei, dass sich Wissen über partizipative Forschung in der deutschsprachigen (Sozial-)Wissenschaft verbreitete und der Ansatz weiter an Bekanntheit gewann. So wirkte PartKommPlus an der Etablierung und Internationalisierung von Partizipativer Gesundheitsforschung in Deutschland mit [2].
Neben den positiven Reaktionen und Wirkungen im Wissenschaftsbereich traf PartKommPlus mit dem partizipativen Ansatz auch auf Widerstand [2]. Es scheint schwer überwindbare Gräben zu geben zwischen einem dominanten Wissenschaftsparadigma, welches die Expertise von akademisch Forschenden am bedeutsamsten bewertet, und dem partizipativen Wissenschaftsverständnis, bei dem das Wissen verschiedener Akteur*innen gleichermaßen wertgeschätzt wird [4].
Beteiligungsorientierten Ansätzen wird zunehmend Relevanz zugeschrieben, was sich zum Beispiel an wachsenden Publikationszahlen zu diesem Thema zeigt [5]. Eine spürbar wachsende Offenheit und ein gesteigertes Interesse an partizipativer Gesundheitsforschung innerhalb verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen war fördernd für die Verbreitung und Rezeption von Erkenntnissen aus dem Forschungsverbund [2].
Weiterführenden Informationen und Beispiele der Wirkungen von PartKommPlus auf der Ebene der Wissenschaft sind im Anhang zu finden.
Resümee
Angelegt an die zu Beginn angestrebten Wirkungen, die durch die Arbeit von PartKommPlus angeregt werden sollten, bestätigte sich, dass auf Ebene der beteiligten Personen und Partner*innen im Verbund vielseitige Wirkungen auftraten. Auch konnten in den meisten der beteiligten Kommunen Veränderungen angestoßen werden und Strukturen für eine partizipativ ausgerichtete kommunale Gesundheitsförderung initiiert und weiterentwickelt werden. Wo vereinzelt die Zusammenarbeit mit der kommunalen Verwaltung nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, wurden Einzelmaßnahmen der Gesundheitsförderung vor Ort entwickelt. Es wurde deutlich, dass Partizipative Gesundheitsforschung lokales Wissen erzeugt und positive Wirkungen besonders dort möglich werden, wo die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteur*innen gelingt. Vielfältige Wege wurden eingeschlagen, um Praktiker*innen der Gesundheitsförderung auch außerhalb von PartKommPlus zu erreichen (z. B. durch praxisnahe Produkte oder Netzwerkarbeit); allerdings kann noch nicht eindeutig belegt werden, welche Wirkungen dies auf die Praxis der kommunalen Gesundheitsförderung insgesamt hat. Hervorzuheben sind hier die Weiterbildungsformate, die aus PartKommPlus hervorgingen, und auf reges Interesse stoßen. Auch die möglichen Wirkungen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen können zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend eingeschätzt werden. In vielen Bereichen konnte Interesse geweckt und bestärkt sowie Erkenntnisse aus und über partizipative Gesundheitsforschung verbreitet werden. Inwieweit diese Wirkungen zu Veränderungen in der Forschungs- und/oder Gesundheitsförderungspraxis führen, wird sich wohl erst zukünftig offenbaren. Insgesamt konnte PartKommPlus mit dazu beitragen, dass sich die Bedingungen für die Partizipative Gesundheitsforschung in Deutschland derzeit verbessern und damit einer weiteren Entwicklung und Etablierung dieses Forschungsansatzes den Weg ebnen.
Ausblick
Diese Wirkungsbeschreibung ist eine Momentaufnahme. Wirkungswege setzen sich nach Abschluss von Forschungsprojekten fort und können nach allen Seiten ausbreitende Welleneffekte (sog. ‚ripple effects‘) anstoßen. Daher können weitere Wirkungen erwartet werden, welche beispielsweise über Veränderungen der Partizipationskultur bei den beteiligten Institutionen, Fachkräften und Wissenschaftler*innen oder über die Anwendung von PartKommPlus-Produkten und Veröffentlichungen angeregt werden. Schon jetzt gibt es Ideen und Konzepte für Nachfolgeprojekte und Weiterbildungen, die auf Erkenntnissen aus PartKommPlus beruhen – beispielsweise setzt ein Praxispartner von ElfE mit den Eltern eine Workshopreihe in Eigenregie fort. Allerdings gibt es auch Unsicherheiten bezüglich der Verstetigung von entwickelten Maßnahmen und dem Transfer von Forschungsergebnissen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Nachhaltigkeit der Arbeit des Verbundes noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Potential und Anschlussfähigkeit sind jedoch vorhanden.
Quellen, Hinweise und Belege
- Wright MT, Hartung S, Bach M et al. (2018) Impact and Lessons Learned from a National Consortium for Participatory Health Research. PartKommPlus - German Research Consortium for Healthy Communities (2015–2018). BioMed Research International 2018:5184316. doi.org/10.1155/2018/5184316
- PartKommPlus (2020) Ergebnisse der PartKommPlus Dokumentenanalyse. Fokus: Gesamtverbund. Kommentierte Fassung der Verbundmitglieder, Nicht-öffentliches Dokument
- PartKommPlus (2020) Dokumentation des 10. PartKommPlus-Kolloquiums, Nicht-öffentliches Dokument
- Wallerstein N, Giatti LL, Bógus CM et al. (2017) Shared Participatory Research Principles and Methodologies: Perspectives from the USA and Brazil-45 Years after Paulo Freire's "Pedagogy of the Oppressed". Societies (Basel) 7. doi.org/10.3390/soc7020006
- Clar C, Wright MT (2019) Partizipative Forschung im deutschsprachigen Raum – eine Bestandsaufnahme. https://opus4.kobv.de/opus4-ash/files/324/Clar+Wright_Partizipative+Forschung_2019.pdf
Den Anhang mit weiterführenden Beschreibungen der Wirkungen, weiteren Quellen und verschiedenen Beispielen aus dem Verbund finden Sie hier: